Repository | Book | Chapter
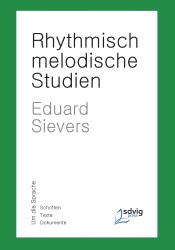
(2014) Rhythmisch-melodische Studien, Genève-Lausanne, sdvig press.
Publication details
Full citation:
Sievers, E. (2014). Über ein neues Hilfsmittel philologischer Kritik, in Rhythmisch-melodische Studien, Genève-Lausanne, sdvig press, pp. 135-162.
NOTES
1 S. darüber die Vorbemerkung S. 5f.
2 Einiges Weitere hierzu s. in meiner Phonetik 5 § 654 ff.
3 Eine weitere Spezies von Selbstlesern ist mir erst neulich entgegengetreten, lange nachdem das Obenstehende geschrieben war. Wer diesen Dingen besonders hilflos gegenübersteht und sich in glücklichem Wahn doch stärker fühlt als andere Leute, der besteigt auch wohl das Roß der Selbstgerechtigkeit und sucht die Wissenschaft mit Geschrei vor der Unwissenschaft zu retten, statt mit Gründen. Besonders eifervolle Stilübungen in dieser Richtung s. neuestens im Anzeiger für deutsches Altertum 34, 222 ff. — Was würde man wohl dazu sagen, wenn sich die Farbenblinden zusammentäten, um den Normalsichtigen ihre Farbenempfindungen wegzudisputieren, weil sie sie nicht in gleicher Weise haben? In der Philologie aber dünkt sich ein Tauber der oben gekennzeichneten Art wohl gar eigens deswegen zum Richter berufen zu sein, weil er taub ist, oder weil er doch noch nicht gelernt hat, richtig zu hören, was um ihn herum vorgeht. — Womit ich mich übrigens selbstverständlich nicht auf jeden Einzelansatz bei Habermann oder irgendeinem anderen Beobachter festgelegt haben will: Irrtümer sind ja bei einer so schwierigen Sache überall möglich und zurzeit auch wohl noch unvermeidlich. Um so ernster und mit um so besserem Willen sollte man diesen denn doch wahrhaftig wichtigen Fragen zu Leibe gehen.
4 Gegenüber der Skepsis, welche dieser Anschauung auch in neuester Zeit noch von verschiedenen Seiten entgegengebracht wird, muß ich so schroff wie möglich betonen, daß die Sache selbst außer allem Zweifel steht. Zweifeln kann nur, wer nicht in der Lage gewesen ist, die Sprechweisen unbefangen und voraussetzungslos redender Nieder- und Hochdeutscher zu vergleichen, namentlich wenn er selbst einem derjenigen Gebiete angehört, wo das Schwanken zwischen den beiden Gebieten (s. oben S. 63) sozusagen endemisch ist. Als möglich zuzugeben ist nur dieses. Wie ich in meiner Phonetik5 §666 ausgeführt habe, sind nur die habituell bedingten Tonhöhengegensätze umlegbar, nicht die mechanisch bedingten (§ 665). Durch eine den Typus des Autors verlassende Umlegung wird also niemals ein ganz reines Resultat erzielt, sobald mechanisch bedingte Tonhöhendifferenzen in Frage kommen; es entstehen also in solchen Fällen sicherlich gewisse melodische Störungen, und es ist denkbar (wenn auch vorläufig noch nicht erwiesen), daß ein empfindliches Ohr diese instinktiv herausfindet und der Besitzer dieses Ohres dadurch getrieben wird, die betreffenden Stellen gegen seine eigene angestammte Weise im Sinne des ihm konträr liegenden Autors zu intonieren.
5 Zur Ergänzung möchte ich, um sonst möglichen Irrtümern vorzubeugen, hier noch zwei für die Kontrolle wesentliche Beobachtungen mitteilen. Die eine ist die, daß die typische Satzmelodie eines Autors jedesmal soviel Text umspannt, als er (und sein Leser nach ihm bei der Reproduktion) psychisch zusammennimmt. Es fallen daher nicht nur oft längere Satzgebilde zwangsweise in melodische Teilstücke (mit jeweils vollständiger Melodiekurve) auseinander, weil des Inhaltes zu viel oder zu verschiedenes ist, als daß man binden könnte; sondern man kann oft auch bindbare Stücke durch willkürliche Gliederung, eventuell durch Pausen, trennen. Auch dann pflegt jedes Teilstück, soweit es angeht, die volle Kurve zu bekommen, unter Umschiebung der charakteristischen Töne dieser Kurve auf entsprechend gelegene Silben des Teilstückes. — Fast noch wichtiger für die Praxis ist die zweite Beobachtung, weil sie eine Menge scheinbarer Anomalien aus dem Wege schafft. Oft scheinen nämlich die Melodiekurven einer Satzfolge nicht zu stimmen; beispielsweise beginnt da etwa der eine oder andere Satz gleich mit einem hohen Ton, während die Mehr zahl tief einsetzt und erst durch einen Steigschritt die Höhe erreicht. In solchen Fällen liegen aber doch nicht andere Kurven vor, sondern nur Teilstücke der Hauptkurve, und die fehlenden Stücke werden pausiert, damit man das Fehlende, wenn auch unbewußt, in Gedanken durchlaufen kann. Einem jeden Fehlstück der Hauptkurve entspricht also beim Vortrag eine Zwangspause, die man nicht ausschalten kann, ohne melodisch ins Stocken zu geraten. Bei der Beurteilung der Konstanz der Kurven sind diese Pausen natürlich stets mit zu berechnen.
6 Jedoch im allgemeinen nur, wenn man die beiden Halbzeilen auch im Vortrag zu einer (rhythmischen) Periode verbindet. Isoliert man die beiden Hälften der Periode voneinander, so bekommen sie, im Anschluß an das S. 98 in der Fußnote Bemerkte, beide die Kurve . · .; man spricht also z. B. isolierend (ohne den vorausgehenden Vordersatz) vielmehr Und si.nken ti·ef ins Mee.r und Trank ni.e einen Tro·pfen me.hr (bzw. umgekehrt bei hochdeutscher Intonation).
7 Man verkleinere bei mehrmaliger Wiederholung des Textes stufenweise sämtliche Intervalle, indem man gleichzeitig durch die Mittelstufe des Murmelns in ein bloßes Summen übergeht, bei dem schließlich alle betonteren Silben in ein und denselben Summton zusammenfallen. Das ist dann der gesuchte Durchschnittston.
8 Die fortgesetzte Untersuchung hat mir gezeigt, daß mit der Melodik allein nicht zum Ziel zu gelangen ist. Wesentlich weiter gelangt man schon durch die Herbeiziehung der Rutzschen Unterscheidungen verschiedener Stimmqualitäten bzw. der mit dem Wechsel der Stimmqualitäten (und Autoren) parallel gehenden verschiedenartigen Reaktionen der Rumpfmuskulatur. Auf diese kann ich aber hier natürlich nicht eingehen, ohne die ganze Art der Untersuchung auf einen Stand zu verschieben, den sie vor dem Bekanntwerden der Arbeiten von Josef Rutz und seiner Familie im Jahre 1908 nicht haben konnte. Überdies bleiben auch dann noch praktische Schwierigkeiten genug, wenn man Rutzsche Reaktionen benutzt.


